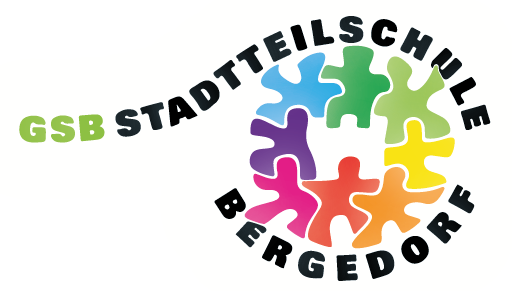Ergebnisse eines Interviews mit Frau Beate Stratemann (*1934)
Ich, Beate Stratemann geb. Bohnert, bin am 17. Juni 1934 in Köln-Bickendorf geboren. Meine Eltern, beide noch recht jung, wohnten damals in Köln-Riehl, Duisburger Str. 14. Meine ältere Schweste und ich haben den Krieg bewusst miterlebt, so wie er in den Großstädten stattgefunden hat. Unsere beiden jüngeren Schwestern waren wohl noch viel zu klein, um sich an alles zu erinnern. Meine Großmutter väterlicherseits wohnte in Köln-Bickendorf in einem Eigenheim und dort habe ich den 1. September 1939 miterlebt. Ich erinnere mich noch ganz genau, dass meine Großmutter, eine echte Kölnerin, zur Nachbarin ging und aufgeregt sagte: „Frau Schmitz, wir haben Krieg!“ Damals sagte mir das nichts, aber recht bald begriff ich, was los war. Mein Vater war Optiker, jedoch zur Zeit arbeitslos wie so viele Menschen damals. Er meldete sich freiwillig als Berufssoldat bei der Wehrmacht. Dadurch hatten meine Eltern dann auch einige Vergünstigungen. Es gab für junge Paare das sogenannte Ehestandsdarlehen. Bei jedem neu geborenen Kind wurden die zurückzuzahlenden Schulden weniger.

In den ersten zwei Kriegsjahren gab es kaum Bombenangriffe, aber es hatte sich vieles verändert. Alle Fenster mussten am Abend verdunkelt werden, es brannten keine Laternen mehr. Ein Luftschutzmann kontrollierte am Abend die Straßen und schellte dort an, wo noch ein wenig Licht nach draußen kam. In der Schule gab es ein neues Fach „Luftschutzalarm“. Wir mussten beim Ertönen der Sirenen in den Keller flüchten, die Gasmaske aufsetzen und üben, durch das Brandloch in der Mauer von einem Keller in den anderen zu gelangen, bis wir die Flucht nach draußen geschafft hatten. Zuerst war es lustig, später nicht mehr! Auf dem Weg zur Schule musste ich auch die Straßenbahn benutzen, gab es unterwegs Fliegeralarm, mussten wir schnell versuchen einen nächstgelegenen Rohrbunker zu erreichen. Diese Bunker waren sehr eng.
Am Eingang standen zwei Personen, die mit einer Handpumpe für die Luftzufuhr sorgten. Erreichten wir den Rohrbunker nicht rechtzeitig, so war es auch erlaubt, an jedem Haus zu läuten, um im Keller Schutz zu finden. Die Bombenangriffe nahmen jetzt zu. So mussten wir täglich um 17.00 Uhr zu Bett. Im Flur stand von jedem Kind ein Köfferchen, die Puppe obendrauf und die Reisetasche unserer Mutter. Um 20 Uhr gab es regelmäßig den sogenannten Voralarm. Dann mussten wir aufstehen, uns anziehen und in den Keller gehen. Da gab es dann auch schon den Akutalarm, also waren Bomber über unserer Stadt.
Meine Mutter hatte es nicht leicht, vier kleine Mädchen aus dem Schlaf zu reißen, zum Anziehen zu bewegen, die Sachen zu schnappen und in den Keller zu gehen. Erst heute ist mir richtig bewusst, was meine Mutter und viele andere Mütter auch, damals geleistet haben, Männer waren ja nicht dabei. Die kleinen Kinder weinten viel, wir größeren schauten immer auf unsere Mütter und immer, wenn sie sich die Ohren zuhielten und den Kopf senkten, wussten wir, gleich fallen die Bomben. Eine Brandbombe landete in unserem Mehrfamilienhaus in der oberen Etage im Bett einer alten kranken Frau, die noch im Bett lag. Meine Mutter hat sie aus dem Qualm herausgezogen und die Bombe mit dem Federbett erstickt. Dann kam die Entwarnung, wir konnten aber nicht sofort in unsere Wohnung, denn ein Wasserrohr war geplatzt. Die Kinder wurden dann einfach auf die hohen Mülltonnen gesetzt, bis es durch die Luftschutzleute gelang aus dem Keller zu kommen. Ich glaube nicht, dass ich damals als kleines Mädchen den Ernst der Lage richtig erkannt habe. Für meine Mutter war es nach jedem Bombenalarm wichtig zu sehen, dass der Dom noch stand. Auf dem Schulweg haben wir dann Bombensplitter gesammelt, die standen hoch im Kurs. Wir haben damit getauscht.
Jetzt wurde es meiner Mutter zu gefährlich und so kümmerte sie sich um einen Kinderlandverschickungsplatz für meine ältere Schwester und für mich. Das klappte auch sehr schnell. Mit der NSDAP (Nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei) wurden wir zwei nach Graz in Österreich verschickt. Meine Großeltern mütterlicherseits wohnten in der Innenstadt von Köln, nahe dem Bahnhof und so brachte meine Mutter unsere Koffer einen Tag vorher mit der Straßenbahn dort hin. In der Nacht gab es einen folgenschweren Bombenangriff. Als wir unsere Koffer abholen wollten, gab es diese ganze Straße nicht mehr. Meine Großeltern hatten im Hochbunker überlebt.
Kinderlandverschickung
Nur mit einem Pappschild um den Hals traten wir unsere beschwerliche Reise nach Graz an. Begleitet von DRK-Schwestern fuhren wir los. Wir winkten und weinten und unsere Mutter ebenfalls. Mit Singen von Hitlerliedern wurden wir bei Laune gehalten. Der Zug fuhr langsam. In München hieß es auf einmal für alle: Aussteigen. Wir mussten zu Fuß weitergehen und der Zug fuhr im Schneckentempo ganz langsam weiter. Es hieß damals, er sei über einige Blindgänger gefahren. Es passierte dann aber zum Glück nichts und wir durften nach einem Kilometer wieder einsteigen. In Graz angekommen, wurden wir an Pflegeeltern verteilt. Ich erinnere mich noch genau, dass zwei große warme Hände mich hochhoben, über den Zaun setzten und eine mütterliche Stimme sagte: „Die Kleine nehm ih!“ Und weg war ich, getrennt von meiner Schwester, die ich aber dann in meiner Nachbarschaft wiedersah. Ich hatte liebe Pflegeeltern, zu deren Tochter ich noch heute Kontakt habe.

Nach sechs Wochen fuhren wir die gleiche Tour wieder zurück. Die Luftangriffe auf Köln hatten sich verstärkt. Mein Vater bekam Heimaturlaub und hatte es sich so schlimm, wie es hier jetzt war, nicht vorgestellt. Ich höre ihn heute noch sagen: „So schlimm ist es ja draußen im Feld nicht mal.“ Abend für Abend sahen wir die Scheinwerfer, die den Himmel nach Flugzeugen absuchten. Befand sich ein Flugzeug im Scheinwerferlicht, versuchte die Flak es abzuschießen. Es wiederholte sich nun alles in kürzeren Abständen: Fliegeralarm, Keller, schwere Bomber, Angst und die Tränen der Mutter.
Und so wurden wir nochmals mit dem Kindertransport zu neuen Pflegeeltern geschickt: Nürnberg, Halle (Saale), Grenze, Thüringen, Alternahr. Dadurch habe ich mich innerlich immer weiter von meiner Mutter entfernt. Das hat mein späteres Leben in familiärer Hinsicht beeinflusst. Heute ist meine Mutter 93 Jahre alt, stark dement. Ich bin ihre amtlich bestellte Betreuerin. Heute ist es mir gelungen, meine Mutter besser zu verstehen und sie so zu lieben, wie sie nun mal ist. Sie hat Unvorstellbares geleistet und wäre wohl für jedes ihrer vier Mädchen durchs Feuer gegangen. Sie war stark, trotz ihrer vielen Tränen.
Tränen, die sie weinte, wenn der Postbote kam und keinen Feldpostbrief meines Vaters für sie dabeihatte. Feldpostbriefe meines Vaters habe ich noch. Ich habe sie jedoch nicht gelesen, denn sie waren nur für meine Mutter bestimmt. Nachdem mein Vater aus der Gefangenschaft zurückgekommen ist, hatte er einen schweren Start. Er durfte 89 Jahre alt werden.
Hier höre ich auf. Ich könnte noch etliche Seiten schreiben, ich mag nicht mehr, denn während ich hier schreibe und nachdenke, höre ich die dumpfen Bombenflieger und alles wird wieder lebendig. Ich wünsche mir, dass unsere nachkommende Generation solch einen Krieg nicht erleben muss, dass alle Menschen ihren Verstand richtig einsetzen, so wie Gott es gewollt hat. Wir könnten dann alle in Frieden leben. Leid und Tränen blieben uns erspart.
Wir trauern um die Redaktionsmitglieder, die uns für immer verlassen haben.





Unsere Ziele sind relativ schnell formuliert. Wir wollen einen Beitrag zu lebendiger Erinnerungskultur leisten, indem wir individuelle Geschichten und Erfahrungen einer breiten Masse zugänglich machen. Ebenso fördern wir mit unserem Projekt auf unterschiedlichen Ebenen den Austausch zwischen verschiedenen Generationen, die viel voneinander lernen können

Freitag, 28. November 2025 – 15 bis 18 Uhr