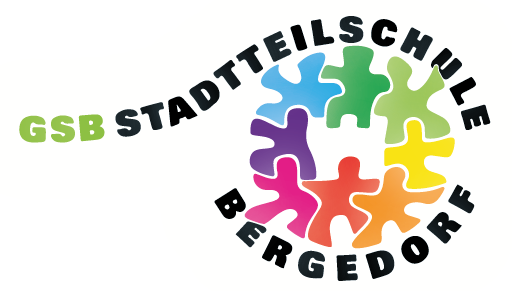Interview mit Bodo Cousin, geb. 28. Oktober 1914
Nach dem ersten Weltkrieg stand meine Mutter alleine da und musste zwei Kinder, mich, damals drei Jahre alt und meine Schwester, die vier Jahre älter war, ernähren. Mein Vater war 1917 in Rumänien gefallen und meine Mutter stand vor dem Nichts. Hilfen für sozial Schwache oder Arbeitslose gab es damals nicht, wie sie heute in unserem Sozialstaat existieren.
Meine Mutter musste also jeden Beruf ergreifen, um Geld zu verdienen. Sie arbeitete beispielsweise in der Schokoladenfabrik Reichert und packte Schokoladentafeln ein. Außerdem erlernte sie den Frisörberuf und ging morgens in den wohlhabenderen Teil Wandsbeks, Mariental, um dort Damen zu frisieren. Mittags musste sie jedoch wieder zu Hause sein, da wir Kinder aus der Schule kamen und Hunger hatten. Des Weiteren musste neben dem Kochen die Wäsche gemacht werden. Hinzukamen noch andere Haushaltspflichten. Nach dem ersten Weltkrieg kam es zu Ernährungsengpässen. Einige Menschen hatten allerdings einen eigenen Schrebergarten oder Verwandte mit großem Garten. Mein Großvater besaß so einen großen Garten, sodass wir keinen absoluten Hunger leiden mussten. Selbst auf kleinen Flächen wurde damals ganz intensiv Landwirtschaft betrieben. Wir hatten damals Stachelbeeren und Kirschen, Birnen und Äpfel, Kartoffeln und Rüben, selbstverständlich alles im Eigenanbau.
Ich selbst kam mit sechs Jahren in die Grundschule. Wir wurden in zwei Klassen eingeteilt, da es über sechzig Schüler waren, die neu eingeschult wurden. Neben meiner Mutter stand eine Frau, die, während sie auf mich zeigte, dem Lehrer sagte: „Den werden Sie auch wohl nicht lange haben“. Vor meiner Schulzeit litt ich nacheinander an vier verschiedenen Krankheiten, darunter Diphtherie und Masern. Meine Beine waren so dünn, dass die selbstgestrickten, langen Strümpfe an ihnen schlotterten. Hinzukam die Tatsache, dass ich geradezu leichenblass aussah. Trotzdem behielt die Frau nicht Recht.
Ich hatte viele gute Lehrer und war in den ersten vier Schuljahren auch ein guter Schüler. Von der Volksschule (heute Grundschule) wechselte ich zum Realgymnasium, welches eine gute Viertelstunde von unserer Wohnung entfernt lag. Jeden Morgen musste ich die sogenannte Schulstraße in Wandsbek entlang gehen, wo zwei alte Schulen zu Arbeitsämtern umfunktioniert worden waren.
In den Arbeitsämtern mussten sich damals die Arbeitslosen jeden Tag zum Stempeln ihrer Arbeitslosenkarte vorstellen, um kontrollieren zu können, ob sie nicht schwarzarbeiteten. Jeden Morgen sah ich also auf diesen Schulhöfen Tausende von Leuten, ein Heer von Arbeitslosen, die dort zum Stempeln gingen. Diese Arbeitslosen sah ich jahrelang.
Während meiner Schulzeit, befand sich gegenüber unserer Wohnung die Geschäftsstelle der Kommunistischen Partei. Parallel dazu entwickelte sich auch die Nationalsozialistische Partei. Auffällig für mich waren die uniformierten Kommunisten, die mit Musikinstrumenten, durch die Straßen zogen, um für sich zu werben. Auf der anderen Seite marschierten die Nationalsozialisten mit Trommeln und Pfeifen, wie das Militär sie hatte, und machten ebenfalls lautstark für ihre Partei Werbung. Von Zeit zu Zeit kam es auch zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Mit Ereignissen wie diesen war ich damals konfrontiert.
Das Thema der Arbeitslosigkeit verfolgte mich weiterhin, weil ich nach der Schulzeit das Studium eines Ingenieurs für Wasserwirtschaft aufnahm. Während der Semesterferien musste ich Geld verdienen und war bei einer Firma tätig, die nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten den Auftrag bekam, den Autobahnbau nach Bremen zu unterstützen und zwar nicht mit Hilfe normaler Arbeiter, sondern mit „Notstandsarbeitern“. Dabei handelte es sich um Arbeitslose, die in Hamburg am ZOB in Autobusse geladen, auf die Baustelle gefahren, dort mit Schaufeln und Spaten ausgestattet wurden und das Planum für die Autobahn herstellten. Sie schaufelten also, ganz egal was sie von Beruf waren, ob Professor, Handwerker oder ungelernter Arbeiter. Diejenigen, die mit Schaufeln und Spaten nicht umgehen konnten und es auch nach drei Tagen nicht lernten, wurden nach Hause geschickt und mussten sich mit ihrem Arbeitslosengeld zufrieden geben.
Der Nazistaat führte die sogenannte „Wertschöpfende Arbeit“ ein, das heißt, Arbeitslosengeld plus Notstandsarbeitsgeld wurden in „Wertschöpfende Arbeit“ umgesetzt. Es wurde keine Rücksicht auf erlernte Berufe genommen. Jeder musste den Aufforderungen der Regierung Folge leisten. Den Zwang zur Notstandsarbeit gab es auch nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg. Der Gedanke an die Handhabung der Arbeitslosigkeit verfolgt mich auch heute noch. Auch in dieser Nachkriegszeit existierte eine hohe Anzahl von Arbeitslosen, das wiederum mit Notstandarbeiten beschäftigt werden konnten. Ich war zu der Zeit bei der Baubehörde in Hamburg tätig und habe selber so eine Maßnahme im Ohmoor in Niendorf bei Hamburg durchgeführt. Dort wurde ein Moor kultiviert. Mit Hilfe von Notstandsarbeitern wurde Torf gestochen und einer Firma zur Verfügung gestellt, die ihn „wertschöpfend“ zu Mutterboden weiter verarbeitete.
Ein weiterer Aspekt wären ein paar Ereignisse technischer Art, welche mich damals sehr beeindruckt haben. Zum einen wäre da der Lieferwagen „Tempo“, ein dreirädriges Gefährt, das man als Auto bezeichnete und welches auch heute noch nachgebaut wird. Den „Tempo“, der in Wandsbek hergestellt wurde, nannte man auch „Rollfix“. Die Tempoleute, die in der Schulstraße ihre Fabrik hatten, machten ihre Probefahrten immer in unseren Straßen, sodass wir die Entwicklung des „Tempo“, von einer offenen Dreiradkarre bis zu einem Wagen mit geschlossener Fahrerkabine, miterleben konnten. Außerdem das Luftschiff „Graf Zeppelin“, das 1930 nach Hamburg kam und am Flughafen Fuhlsbüttel landete. Ich erinnere mich, dass ich als Vierzehnjähriger mit meiner siebzehnjährigen Schwester und meiner Mutter auf dem Flachdach unseres vierstöckigen Hauses standen und ich mit meinem ersten Fotoapparat, aufklappbar mit Balgen und Platten, scharf darauf war, diesen Zeppelin zu fotografieren. Auch der Schienenzeppelin, ein propellergetriebener Triebwagen, der von Hamburg nach Berlin in einer rasenden Geschwindigkeit von 150 bis 200 Kilometer pro Stunde fuhr und ein Flugboot Dornier Do X., welches in Hamburg auf der Alster landete, gehörten dazu. Für dieses Flugboot und andere Wasserflugzeuge der Firma Blohm & Voß musste ein Wasserflughafen gebaut werden. Das Mühlenberger Loch, das heutzutage immer wieder erwähnt wird, weil es für die Herstellung des Airbus teilweise als Arbeitsfläche benötigt und damit verfüllt wird, war ursprünglich überhaupt keine Wasserfläche sondern festes Land. Diese Fläche wurde Anfang der dreißiger Jahre für einen Wasserflughafen mit nur geringer Wassertiefe, zur Verringerung des Wellenschlages, ausgebaggert.
„Hilf Dir selbst, dann hilft Dir der liebe Gott!“ hieß es damals. Dies bedeutet, dass man fleißig sein und nicht darauf warten soll, dass andere helfen, sondern selbst anpacken muss.
Wir trauern um die Redaktionsmitglieder, die uns für immer verlassen haben.





Unsere Ziele sind relativ schnell formuliert. Wir wollen einen Beitrag zu lebendiger Erinnerungskultur leisten, indem wir individuelle Geschichten und Erfahrungen einer breiten Masse zugänglich machen. Ebenso fördern wir mit unserem Projekt auf unterschiedlichen Ebenen den Austausch zwischen verschiedenen Generationen, die viel voneinander lernen können

Freitag, 28. November 2025 – 15 bis 18 Uhr