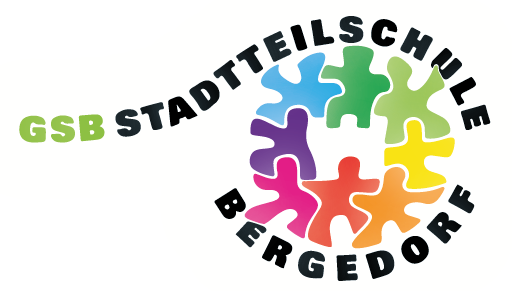Interview mit Frau Winkelmann (* 1911)
Wo sind Sie damals aufgewachsen?
Ich wurde in Hamburg‑Eppendorf geboren. Ich war ein uneheliches Kind
War das damals nicht eine große Schande, ein uneheliches Kind zu sein?
Ja, damals war das leider so. Hinzu kam noch, dass mein Großvater Pastor war, so wurde meine Mutter verdammt.
Sie wurde verdammt? Was meinen Sie damit?
Meine Mutter wurde verachtet. Sie wurde als „Schande für die Menschheit“ angesehen, so musste ich zu Pflegeeltern.
Was ist dann mit Ihnen passiert?
Ich wuchs die ersten Jahre bei Pflegeeltern auf, die mich für Geld in die Familie aufnahmen. Konnte meine Mutter das Pflegegeld nicht mehr aufbringen, gab man mich an Mutter zurück.
War es schön bei den Pflegefamilien?
Naja schön, weiß ich nicht so recht. Hatten die Familien eigene Kinder, wurde man nicht wirklich gut behandelt. Man war nur Mittel zum Zweck, um an Geld zu kommen
Wollte Sie denn keine Familie adoptieren?
Doch, mit 11 Jahren wurde ich dann adoptiert. Ein Mitspracherecht und eine Kontrolle durch ein Jugendamt, wie es das in der heutigen Zeit gibt, gab es damals noch nicht
Wurde diese Familie Ihre richtige Familie?
Ich hatte endlich eine Familie, die für mich sorgte.
Was war Ihr Vater beruflich, hat er damit viel Geld gemacht?
Mein Vater arbeitete bei der Eisenbahn. Wir wohnten am Rothenburgsorter Bahnhof Es waren nach dem ersten Weltkrieg schwere Zeiten. Um unseren Speisezettel zu ergänzen, hielten wir uns auf dem Balkon Kaninchen. Als Kinder mussten wir dann nachmittags am Bahnhof oder auf freien Grünflächen Kaninchenfutter pflücken. Mit dem Geld war das damals also nicht so toll.
Gingen Sie eigentlich zur Schule, wenn Sie immer zu anderen Familien mussten?
Ich besuchte die Volksschule, wie es damals hieß, und später dann den „Oberbau“. Heute nennt man das Realschule. Dort machte ich meine Mittlere Reife
An was erinnern Sie sich während ihrer Schulzeit?
In der schlechten Zeit nach dem Krieg gab es damals, genau wie auch nach dem ersten Weltkrieg, für zarte und unterernährte Kinder eine Schulspeisung. Ich musste dann immer eine Schüssel und einen Löffel mit in die Schule nehmen, darin bekamen wir dann unsere Mahlzeit zugeteilt. Ich gehörte auch mit zu den ersten Kindern, die zur Erholung in ein Schullandheim auf Sylt geschickt wurden. Außerdem kann ich mich noch gut daran erinnern, dass wir im Vergleich zu heute sehr brave Kinder waren. Wir mussten immer stets pünktlich zu Hause sein. Mit Jungs sprechen, gar „anbändeln“, kam überhaupt nicht in Frage. Die Schulen waren noch streng getrennt in Mädchen- und Knabenschulen.
Ach, und an meinen Schulweg kann ich mich auch noch erinnern. Jedes Jahr das gleiche: vom Sommer bis Herbst musste ich immer zwei Stunden mit der Bahn fahren, um zur Schule zu kommen.
Warum nur vom Sommer bis zum Herbst?
Meine Eltern wollten sich gerne ein Haus bauen. So hatte mein Vater ein Grundstück im damals noch ländlichen Schnelsen gekauft. Aber der Bauunternehmer, der mit dem Bau beauftragt wurde, machte sich mit dem Geld davon. So hatten wir in Schnelsen nur eine Art Schrebergartenlaube. Doch jeden Sommer zogen wir dahin und lebten dort bis zum Herbst. Daher musste ich jeden Morgen früh los, um zur Schule zu kommen.
Und wie war es damals mit der Politik, haben Sie sich dafür interessiert?
Politik war für mich als Kind kein Thema. Das war Sache der Eltern und Erwachsenen. So wuchs ich, trotz vieler wichtiger und auch skandalöser Ereignisse in Hamburg, doch recht unschuldig und unbelastet heran.
Wenn Sie sich nicht für Politik interessiert haben, wofür dann?
Ich habe sehr gerne Sport getrieben. Ich war eine gute Turnerin und gehörte damals dem Sportverein an. Ich war damals eine lange Zeit krank und musste daher aufhören. Später traten einige Geschäftsleute, die auch einen Sportverein unterstützten, an meinen Vater heran. Sie wussten, dass ich eine gute Turnerin war und wollten mich gern im Verein haben. Aber mein Vater meinte, dass wäre ihm zu teuer, die Beiträge könnte er nicht bezahlen. Da bot man ihm an, mir eine gute Ausrüstung zu bezahlen und für ein Jahr die Beiträge zu übernehmen.
Was haben Sie eigentlich nach der Schule gemacht?
Als ich aus der Schule kam, hatte ich das Glück, eine Lehrstelle im Büro bei einer Firma, die Korsetts und ähnliches nähte, zu bekommen.
Wie hieß die Firma?
„Gazelle“ hieß die Firma. Der Inhaber war ein Jude und sehr streng. Wir mussten sehr viele Überstunden machen und durften keine eigene Meinung äußern. Aber ich bin trotzdem bei der Firma geblieben, als ich ausgelernt hatte.
Wie kamen Sie an die Firma?
Um eine Stelle zu bekommen, ging ich zu einer Vermittlungsstelle, die es damals gab. Dort musste man seine Kenntnisse vorweisen, einen Lebenslauf schreiben, und wenn man Glück hatte, wurde einem eine Stelle nachgewiesen.
Was mich jetzt noch brennend interessiert ist, wie erlebten Sie die Zeit zur Wirtschaftskrise?
Aus der Zeit der Inflation kann ich mich noch erinnern, dass meine Mutter, wenn Lohntag war, schon früh Vaters Lohn, wenn er ihn bekommen hatte, abholte, um dann sofort einkaufen zu gehen. Denn es war so, dass mittags immer die Preise neu festgesetzt wurden und die stiegen natürlich immer.
Und was ist mit der Zeit der goldenen Zwanziger, wie erlebten Sie die?
Die Goldenen Zwanziger Jahre (Tanzen, Charleston usw.), von denen man heute so schwärmt, habe ich eigentlich nicht kennengelernt.
Wo verbrachten Sie Ihre Kindheit?
Ich wurde in Borna geboren, das war ungefähr fünf km vom Zentrum von Chemnitz entfernt. Borna wurde 1912 dann in Chenmitz eingemeindet.
Wo haben Sie zu dieser Zeit gelebt?
Wir lebten in einem Dorf. Dort gab es auch einen Bahnhof mit einer Station, diese hieß auch Borna. In Wittgensdorf gab es dann auch ein Dorfkino. Dort gab es nur Stummfilme. In Chemnitz hatten wir eine große Orgel, damit wurde dann die Musik zum Film gespielt.
Wie sah es mit Ihren Eltern aus?
Mein Vater hat schon immer sehr viel und sehr gerne getrunken, außerdem hatte er überall viele Freundinnen. Daher hatte es meine Mutter sehr schwer. Sie musste viel arbeiten gehen, damit unsere Familie über die Runden kam. Meine Mutter musste Handschuhe zusammennähen, wobei sie sehr wenig verdient hat. Oft hatten wir viel zu wenig Essen, da das Geld nicht immer reichte.
Wie sah es denn überhaupt mit dem Essen aus?
Meistens gab es Pellkartoffeln mit Quark. Die Milch mussten wir uns immer selber vom Bauern holen und die Eier versteckte man für uns als Unterstützung unten in der Kanne. Man versorgte sich jedoch mit vielem selbst. Wir bewahrten in unserer Kammer unterm Dach das Geräucherte, Wurst und Schinken auf. Es ging von Schlachtfest zu Schlachtfest, denn die Vorräte mussten ein Jahr lang ausreichen.
Zur Weihnachtszeit wurden 12 bis 13 Stollen gebacken, diese wurden dann in einer Truhe aufbewahrt, denn sie mussten noch bis Ostern halten.
Hatten Sie Geschwister?
Wir waren sieben Kinder. Davon kannte ich jedoch nur meine älteste Schwester. Ich war der Jüngste und bevor ich eine von meinen anderen Geschwistern kennenlernen konnte, sind sie alle gestorben. Es starben sehr viele Kinder, da es die Zeit der Epidemien, des Mangels an Hygiene und der Not und Armut war. Meine Schwester starb dann mit 19. Sie wurde schwanger und mein Vater hatte sie beschimpft und verdammt. Schließlich versuchte sie dann, das Kind alleine abzutreiben und starb daran. Zu diesem Zeitpunkt war ich jedoch erst fünf Jahre alt, deswegen hab ich auch nicht allzu viel davon mitbekommen.
Wie haben Sie gelebt? Hatten Sie Gas in Ihrem Haus?
Als wir Gas ins Haus bekamen, gab es keinen Münzapparat. Der Zähler konnte den Verbrauch ablesen und diesen mussten wir dann hinterher bezahlen. Ein Gasstrumpf hatte ein sehr zartes Gewebe und ging, wenn man nicht vorsichtig war, beim Anzünden leicht kaputt. Vorrat konnte man sich leider nicht leisten, weil das zu teuer war.
Wie haben Sie in Ihrem Haus geschlafen?
Wir hatten immer Strohsäcke als Matratzen. Die Bettwäsche war viel zu teuer, daher schliefen alle unter Bettdecken mit Inlett. Die Schlafräume waren in Dachkammern. Die waren nicht isoliert, so wie man es heute kennt. Im Sommer war es dann besonders schlimm. Die Mücken und die Hitze unterm Dach haben uns den Schlaf geraubt.
Wo haben Sie als Kinder gespielt?
In der „Bar“. Das war ein Tal mit einem kleinen Bach. Dort haben wir dann Dämme gebaut und Wasser gestaut. Für uns Kinder war das ein sehr schönes Spiel.
Haben Sie auch mal Fußball gespielt oder gab es bei Ihnen Sportvereine
Nein, Fußball haben wir nie gespielt und Sportvereine gab es ebenfalls nicht. Sport hatte man nur in der Schule gemacht. Wir hatten eine große Wiese und dort haben wir unter anderem Handball oder ähnliches gespielt.
Hatten Sie auch so etwas wie ein Radio, Kopfhörer oder ähnliches?
Nein, so etwas hatten wir nicht. Wir hatten schließlich keine Elektrizität. Es gab ja nur Gas.
Wie war das mit den Instrumenten? Haben Sie auch mal musiziert, z. B. als Sie unterwegs waren?
Also, ich konnte sehr gut Mundharmonika spielen. Meistens haben wir dann mit unseren Freunden zusammen gespielt.
Hatten Sie auch Schwimmbäder?
Nein. Ich konnte auch kaum schwimmen, schließlich musste man sich Schwimmen selber beibringen. In der Schule wurde uns so etwas nicht beigebracht. Und im Sommer gingen wir zu den Fischteichen, was anderes kannten wir in unserem Dorf nicht.
Was verstand man unter Geschäften?
Geschäfte nannte man damals Gemischtwarenläden, die alles mögliche hatten und führten.
Im Jahre 1925 waren Sie ja schon 13. Da haben Sie doch bestimmt auch schon bessere Erinnerungen an ihre damalige Zeit, oder?
Tja, diese Zeit war für mich nicht gerade sehr angenehm. Das Geld hat damals kaum gereicht. Das Leben hatte sich sehr verändert. Die Preise stiegen jeden Tag. Mal hat etwas 10.000 Mark gekostet und am nächsten Tag schon 20.000 Mark.
Und als ich 15 Jahre war, hab ich endlich meinen Pass bekommen.
Was hat sich denn so politisch abgespielt? Haben Sie sich überhaupt für Politik interessiert?
Eigentlich gab es sehr wenig, was die Politik anbetraf. Es gab eine kommunistische Partei, daran kann ich mich noch erinnern. Und es gab Umzüge der KPD. Doch die jungen Leute interessierten sich nicht für Politik. Vor 1935 hatten wir auch nur ganz wenige Nazis. So etwas kannten wir kaum. In Hamburg gab es schon mehr von denen, aber nicht in unserem kleinen Bauerndorf.
Wie war Ihre Schulzeit?
Ich habe, wie auch viele andere Schüler, in meiner Schulzeit nach dem ersten Weltkrieg an der Schulspeisung teilgenommen. Um meine Gesundheit wieder zu stärken, wurde ich von der Schule aus zur Erholung vier Wochen lang auf die Insel Rügen geschickt. Auf diese Weise wurde unterstützt, um das Leben und die Entwicklung der unterernährten Kinder zu verbessern.
Was hatten Sie denn damals für Möglichkeiten, als Sie aus der Schule kamen? Konnten Sie z. B. einen Beruf erlernen oder ähnliches?
Ich wollte den Beruf Maler erlernen. Schließlich war mein Vater auch Maler, und so wollte er unbedingt, dass ich genau dasselbe mache wie er. Ich habe es dann aber nach einiger Zeit wieder aufgegeben und bin abgehauen. Mein Vater war natürlich nicht gerade sehr erfreut darüber.
Und wo haben Sie dann gelebt?
Ich wohnte immer noch bei meiner Mutter in der Wohnung.
Und was haben Sie danach gemacht?
Danach habe ich in einer Fabrik gearbeitet. Diese hat unter anderem auch Federn für Grammophonkurbeln hergestellt. Wir mussten auch für die Öfen in der Fabrik sorgen. Zu dieser Zeit haben wir alle sehr viel Überstunden gemacht und natürlich bekamen wir sehr wenig Gehalt. Ich war so etwas wie der „Kleinste“. Das bedeutete, dass ich ein ungelernter Arbeiter mit einem geringen Verdienst war. Schließlich war ich als Arbeitskraft viel billiger an den Maschinen. Für die Überstunden bekam ich dann 2 Pfennig mehr. Aber dennoch bin ich gerne zur Arbeit gegangen.
Wie viel haben Sie denn so ungefähr verdient?
Das war sehr wenig. Ich bekam pro Woche so um die 16 Mark. Das meiste mussten wir zu Hause wieder abgeben. Da ich noch zu Hause gelebt habe, musste ich so um die 10 bis12 Mark an meine Familie abgeben. Der Rest war dann mein Taschengeld.
Was war denn z. B., wenn man zum Tanzen weggehen wollte?
Da habe ich kein Geld gebraucht. Wir hatten immer Festlichkeiten wie ein Schützenfest, Kirmes oder einen Jahrmarkt. Da hatte man vielleicht mal eine oder zwei Mark in der Tasche. Und das Fahrgeld dorthin hat man natürlich gespart. Wir sind alle zu Fuß gegangen.
Hatten Sie nicht auch irgendwann mal ein Fahrrad?
Erst als ich anfing zu arbeiten, konnte ich mir endlich ein Fahrrad leisten. Dafür hatte ich natürlich viel gespart. Ich kaufte mein Fahrrad bei einem Freund meines Vaters. Dieser Fahrradhändler hat auch sehr gerne mal etwas getrunken, deswegen dauerte es ziemlich lange, bis er mein Fahrrad endlich fertig hatte. Dieses baute er dann aus bestellten Einzelteilen zusammen. Dafür musste ich dann 80 Mark bezahlen und der Fahrradhändler musste verständlicherweise sehr lange auf sein Geld warten.
Wie sah es zum Beispiel mit einem Auto aus?
Autos besaßen nicht viele Leute, nur die, die wirklich reich waren und sich eins leisten konnten. Das war ein besonderer Luxus. Das erste Auto im Dorf hatte bei uns ein Fabrikant. Weil es einer meiner Freunde war, durfte ich manchmal auch mal mitfahren, das war für mich natürlich ein ganz besonderes Ereignis.
Was haben Sie am Wochenende gemacht?
Am Wochenende fuhren wir öfters irgendwo hin. Das konnte man jedoch immer nur Sonntags machen, denn zu dieser Zeit galten die Samstage noch als Arbeitstage. Dann sind wir zum Beispiel mal nach Leipzig oder Dresden gefahren.
Nach Dresden waren es ca. 80 km, die wir mit den Fahrrädern fahren mussten. Das war für uns gar nicht so leicht, wenn man bedenkt, dass die Fahrräder keine Gangschaltung hatten. Wir sind morgens früh losgefahren und kamen spät abends wieder.
Was nahm man sich zu essen mit, wenn Sie so eine Fahrt machten?
Wir nahmen zwei Schnitten Brot mit, damit musste man dann den ganzen Tag lang auskommen. Wir konnten unterwegs nichts kaufen, weil das zu teuer war. Das höchste, was man vielleicht dabei hatte, waren 50 Pfennig, mehr aber auch nicht. Ohne Fahrrad wäre man damals also kaum ausgekommen.
Wie sah Ihr Urlaub aus?
Wenn es mal Urlaub gab, ungefähr für 8 Tage, fuhr man natürlich immer mit dem Fahrrad. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir mit Arbeitskollegen, die gleichzeitig auch Freunde waren, mit dem Fahrrad von Chenmitz aus nach Stuttgart fuhren. Aber man hat sich gefreut, dass man wenigstens überhaupt mal Urlaub hatte.
Waren Sie denn nur Männer oder durften auch mal Mädchen mitfahren?
Nein, das war damals nicht üblich. Mädchen durften auf gar keinen Fall mitkommen. In diesem Alter hatten wir nicht allzu viel Kontakt zu Mädchen. Wir wurden alle viel strenger erzogen, als man es heute kennt.
Was war später mit Ihren Eltern?
Ich habe mit meiner Mutter alleine in ihrer Wohnung gewohnt. Ich war dann der Verdiener im Haus und musste für sie mit sorgen.
Wie sind Ihre Erinnerungen, wenn Sie jetzt wieder zurück denken?
Ich habe noch viele schöne Erinnerungen an die alten Zeiten. Wenn ich jetzt wieder zurück denke, finde ich das nun auch nicht mehr so schlimm. Wenn wir mit dem Fahrrad in eine andere Stadt fahren mussten, war das auch nicht so furchtbar, wie man vielleicht denkt: Wir waren nicht so verweichlicht. Außerdem kannten wir nichts anderes.
Wir trauern um die Redaktionsmitglieder, die uns für immer verlassen haben.





Unsere Ziele sind relativ schnell formuliert. Wir wollen einen Beitrag zu lebendiger Erinnerungskultur leisten, indem wir individuelle Geschichten und Erfahrungen einer breiten Masse zugänglich machen. Ebenso fördern wir mit unserem Projekt auf unterschiedlichen Ebenen den Austausch zwischen verschiedenen Generationen, die viel voneinander lernen können

Freitag, 28. November 2025 – 15 bis 18 Uhr