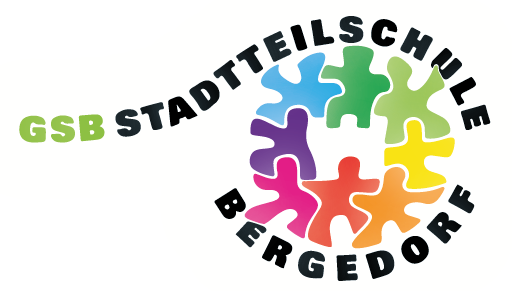Ihr Vater war 40 Jahre an der Deutschen Bank in Bremen tätig. Sie erinnert noch, wie er während der Inflationszeit jeden Tag mit einem Haufen Papiergeld nach Hause kam und die Mutter aufforderten sofort loszulaufen und dafür etwas einzukaufen.
Wie Menschen durch die Inflation all ihr Geld verloren, zeigt die Geschichte ihres Großvaters. Er war der zweite Sohn auf einem Bauernhof in der Nähe von Bremen und konnte als Zweitältester der drei Söhne nicht den Hof übernehmen. Als Abfindung erhielt er 500 Goldmark. Er verließ den elterlichen Hof und entschloss sich, eine Stelle als Forstarbeiter anzunehmen. Die Arbeit im Wald sagte ihm zu, zumal er sich in das Dienstmädchen verliebte, das im Forsthaus arbeitete. Als sie die Försterei verließ, um in Bremen eine Stellung anzunehmen, folgte er ihr. Aus den beiden wurde ein Paar, sie heirateten und arbeiteten hart ihr ganzes Leben lang.
Er verdiente sein Geld in einer Teppichfabrik als Hausmeister. Jeder Pfennig wurde gespart, nichts Unnötiges wurde angeschafft. Von dem ersparten Geld kaufte er ein kleines Haus nach dem anderen und vermietete sie. Die Mieter brachten ihm die Miete ins Haus. Als er älter wurde, hatte er keine Lust mehr, sich um die Verwaltung der Häuser und die Mieteintreibung zu kümmern und verkaufte sie nach und nach. Aber er brachte das Geld weder auf die Bank noch legte er es an, obwohl gerade dazu ihm sein Schwiegersohn der Vater von Frau Kollmann, immer wieder dringend riet.
Der verlorene Krieg war zu Ende, Deutschland musste seine Kriegsschulden bezahlen und das Geld war immer weniger wert. Am Ende der Inflation 1923 hatte er sein gesamtes Vermögen verloren. Jahre später erhielt lediglich die Mutter von Frau Kollmann als seine Erbin eine kleine Abfindungssumme.
Nach 1929 wurde das Leben schwerer. Not hatte die Familie von Frau Kollmann eigentlich nie gelitten, aber das Geld war knapp und es musste an allen Enden gespart werden. Es durfte nicht einfach der Warmwasserboiler angestellt werden, nur weil man sich die Hände waschen wollte. Es durfte auch immer nur eine Glühbirne brennen; wenn man einen Raum verließ, musste das Licht gelöscht werden. Die drei Mansardenzimmer oben in ihrem Haus hatten die Eltern für 30 RM vermietet, und mit diesem Geld wurde auch gerechnet. Als ihre Schulklasse mal auf Klassenreise gehen wollte, hieß es zu Hause, dass dafür wirklich kein Geld übrig wäre. Als sie schließlich dann doch, aber nur mit einem Zuschuss seitens der Schule mitfahren durfte, hat sie sich unendlich geschämt.
Als zu Beginn der dreißiger Jahre die Arbeitslosenzahl auf 6 Millionen angewachsen war, sagte ihr Vater: „Jetzt kann uns wohl nur noch der Hitler helfen!“
Wir trauern um die Redaktionsmitglieder, die uns für immer verlassen haben.





Unsere Ziele sind relativ schnell formuliert. Wir wollen einen Beitrag zu lebendiger Erinnerungskultur leisten, indem wir individuelle Geschichten und Erfahrungen einer breiten Masse zugänglich machen. Ebenso fördern wir mit unserem Projekt auf unterschiedlichen Ebenen den Austausch zwischen verschiedenen Generationen, die viel voneinander lernen können

Freitag, 28. November 2025 – 15 bis 18 Uhr