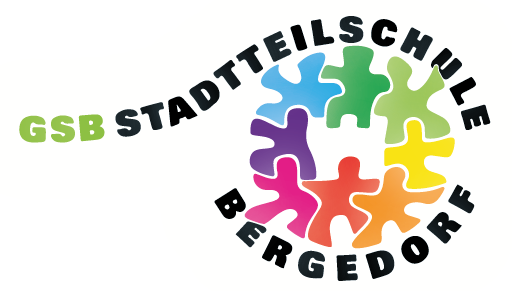Ich heiße Edith Kruse und bin eine geborene Maly, am 6. November 1932 wurde ich in Hamburg-Schiffbek im Rahlstedter Weg geboren. Dort lebte ich mit meinen Eltern, meinem Vater, welcher ein Berufssoldat war und meiner Mutter, einer Fabrikarbeiterin.
Mit sechs Jahren wurde ich in Schiffbek eingeschult.
Bis der Krieg ausbrach, habe ich viel Zeit bei meiner Oma verbracht, da meine Mutter arbeiten musste. Sie war bei einer Firma angestellt, die Promonta hieß, dort wurde unter anderem Nervennahrung hergestellt. Meine Oma besaß in der Möllner Landstraße einen Schrebergarten, in dem ein kleines Holzhäuschen stand. Dieses kleine Häuschen war nach Ende des Krieges das neue Zuhause für meine Mutter, meine Oma und mich, da die Wohnung, in der wir vorher lebten, in Schutt und Asche lag. Ich erinnere mich, dass meine Oma in diesem Schrebergarten viel Obst und Gemüse angebaut hatte. Dort habe ich ihr viel bei der Gartenarbeit geholfen. Ich habe es geliebt die frischen Wurzeln aus dem Boden zu ziehen, um sie dann gleich zu essen.

Als der Zweite Weltkrieg begann, war ich sieben Jahre alt. Meinen Vater habe ich seitdem nie wieder gesehen, denn er musste als Soldat an die Front. Ich kann mich erinnern, öfters Menschen mit einem gelben Stern auf der Brust gesehen zu haben. Man sagte mir, es seien Juden. 1943 wurde ich das erste Mal auf das Land geschickt, nach Niederbayern. Die Frau, bei der ich lebte, hieß Erna Jungwirt. Dort bekam ich dann von meiner Mutter die Nachricht, dass bei einem Bombenangriff unser Haus, in dem wir wohnten, völlig zerstört wurde. Mein Opa Behn, der zu dem Zeitpunkt krank im Bett lag, konnte sich nicht retten und ist in der Wohnung verbrannt.
Die Amerikaner hatten Brandbomben abgeworfen. Meine Mutter und Oma wohnten im selben Haus, konnten sich aber in den Luftschutzbunker retten. Kurz darauf erhielt ich dann die Nachricht, dass mein Vater in Russland bei einem Einsatz getötet wurde. Bei einem Luftangriff traf ihn ein Bombensplitter in den Hals. Da ihm keiner seiner Kameraden helfen konnte, verblutete er. Das war für mich eine sehr schwere und traurige Zeit. Ich kam für kurze Zeit nach Hamburg zurück. Ich erinnere mich an die Momente, wo die Sirenen ertönten und ich mit meiner Mutter so schnell, wie es ging, in einen Luftschutzbunker lief, um dort Schutz zu suchen. Man hörte dann das laute Geräusch von den Flugzeugen und die Explosionen, als die Bomben einschlugen. Da es in Hamburg einfach zu gefährlich war, wurde ich mit elf Jahren wieder verschickt, diesmal in die Tschechoslowakei (heute Tschechien) nach Novy Radek in der Nähe von Prag.
Wir waren zwei Schulklassen, die nur aus Mädchen bestanden, die verschickt wurden. Einquartiert wurden wir in eine Villa eines Sägewerkbesitzers. Dort hatten wir eine strenge Morgenroutine, an welche wir uns halten mussten. Das hieß, morgens früh aufzustehen, die Uniform anzuziehen und die ,,Hitler-Flagge“ hissen. Anschließend mussten wir deutsche Fahnenlieder lautstark singen. Die Uniform bestand aus einem schwarzen Rock, einer weißen Bluse und einem geknoteten Halstuch. Wir Schüler wohnten in den beiden unteren Etagen. Der Sägewerkbesitzer bezog die oberen Etagen. Ich erinnere mich gerne an diesen Mann zurück, da er sehr nett zu uns Kindern war, er feierte mit uns Weihnachten und auch alle anderen Feste. Er versuchte, uns den Aufenthalt so schön wie möglich zu machen. Als ich dann zwölf Jahre alt war, kam die Front immer dichter auf uns zu und wir mussten mit unserer Heimleiterin flüchten.
Auf unserer Flucht konnten wir schon aus der Ferne die russischen Kanonen hören. Anschließend trafen wir deutsche Soldaten, die auf dem Rückzug waren und uns mit nach Bamberg nahmen. Dort wohnten wir für kurze Zeit in einem Kloster, das auf einem Hügel lag, jedoch konnten wir nicht lange bleiben. Man brachte uns in der Nacht zu einem Bahnhof und setzte uns in einen Zug, der uns in die Schwäbische Alp brachte. Unterwegs hielt der Zug und wir mussten alle unter die Waggons kriechen, da Tiefflieger im Anflug waren. Seit jeher gibt es die allgemeine Übereinkunft derart gezeichnete Züge nicht zu beschießen, da allgemein bekannt war und ist, dass mit ihnen neben Kriegsverletzten auch Kinder und Mütter transportiert wurden.
In der Schwäbischen Alp bekamen wir den Saal einer Gaststätte zur Verfügung gestellt, in dem wir übernachten konnten. Vor den Russen waren wir sicher, denn die Amerikaner rückten vor. Ich kann mich noch erinnern, dass eine Lehrerin uns alle auf einen Berg führte, von wo aus wir auf eine Straße schauen konnten. Unten auf der Straße sahen wir amerikanische Truppen fahren. Das war der Zeitpunkt, wo ich das erste Mal Menschen mit schwarzer Hautfarbe gesehen habe. Wir hatten alle große Angst, aber es stellte sich heraus, dass die Soldaten sehr nett waren. Sie versorgten uns mit Essen und anderen Dingen, wie zum Beispiel Seife, sowie uns Kinder mit Schokolade. Als dann der Krieg zu Ende war, wurden wir mit dem Bus nach Hamburg zurückgebracht. In dem Bus bekamen wir alle etwas Geld, um mit der Straßenbahn nach Hause fahren zu können. Ich bin dann nach Billstedt gefahren und zu meiner Oma in den Schrebergarten gegangen. Dort war auch meine Mutter, da ja unser altes Zuhause zerstört war. Die Freude war riesengroß, als sie mich gesehen haben. Wir hatten eineinhalb Jahre nichts von einander gehört.
Wenn ich mich an diese Zeit zurückerinnere, bekomme ich bis heute Gänsehaut. Diese schrecklichen Erlebnisse habe ich immer noch nicht vollständig verarbeitet, sie haben mich schwer traumatisiert. Wenn ich heute einfache Sirenen höre oder Sirenenübungen durchgeführt werden, zucke ich immer noch zusammen und in mir kommen die alten Erinnerungen wieder hoch.
Wir trauern um die Redaktionsmitglieder, die uns für immer verlassen haben.





Unsere Ziele sind relativ schnell formuliert. Wir wollen einen Beitrag zu lebendiger Erinnerungskultur leisten, indem wir individuelle Geschichten und Erfahrungen einer breiten Masse zugänglich machen. Ebenso fördern wir mit unserem Projekt auf unterschiedlichen Ebenen den Austausch zwischen verschiedenen Generationen, die viel voneinander lernen können