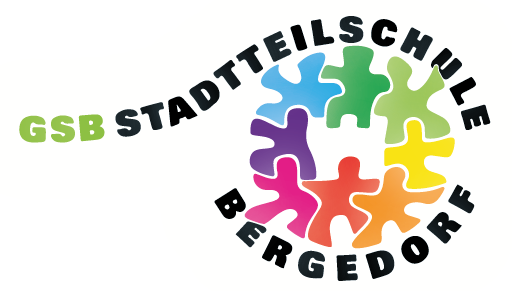Interview mit Zenno Pede, geboren am 17.04.1937 in der Ukraine
Wo sind Sie geboren und aufgewachsen?
Ich wurde am 17.04.1937 in der Ukraine in einem deutschen Dorf des Gebietes Donezk geboren. Ich war der jüngste unter drei Schwestern. Dort lebten wir mit unseren Eltern in einem selbstgebauten Haus.
Warum sehen Sie sich als Deutscher, obwohl Sie in einem anderen Land geboren und aufgewachsen sind?
Mein Großvater hat eine Frau aus Danzig geheiratet. Ein Teil meiner Familie lebte in Deutschland, ein anderer Teil in Russland. Somit waren meine Vorfahren Deutsche. Meine Mutter war Lehrerin und unterrichtete Deutsch und Russisch, deshalb wuchs ich zweisprachig auf.
Welche Auswirkungen hatte Stalins Unterdrückungspolitik auf ihre Familie?
Es fing damit an, dass mein Vater zwei Mal ins Rathaus kommen musste. Dort wurde ihm vorgeschlagen, als Spitzel zu arbeiten. Er lehnte das ab, da er auf dem Feld arbeitete und im Winter als Jäger. Nach weiteren Befragungen und Ablehnungen meines Vaters wurde er in der Nacht auf den 29.11.1937 als angebliches Mitglied einer faschistischen Organisation verhaftet. Sie nahmen ihn mit und beschlagnahmten einige Dinge, zum Beispiel einen Pelz, der für uns als Kälteschutz überlebenswichtig war. Meine Mutter versuchte, meinen Vater weiter zu unterstützen, indem sie Essen und andere Dinge ins Gefängnis brachte. Nach zwei Monaten Haft wurde er am 12.02.1938 erschossen. Dieses Ereignis wurde uns jedoch verschwiegen. Deshalb brachte meine Mutter weiterhin Dinge ins Gefängnis in dem Glauben, meinen Vater damit unterstützen zu können.
Wie haben sie die Zwangsumsiedlung der Sowjetdeutschen erlebt?
Anfang September 1941 befahl die Regierung unter Stalin, dass die sowjetdeutsche Bevölkerung umgesiedelt werden sollte. Die Sowjetdeutschen sollten aus ihren Gebieten umgesiedelt werden, damit diese sich nicht mit dem Feind, den deutschen Truppen, zusammentaten oder austauschten. Die Front war in der Nähe meines Dorfes und die deutschen Truppen rückten in das Land ein. Den Lärm der Flugzeuge und des Krieges hörten wir in unserer Siedlung sehr laut. Nach der Verkündigung unseres erzwungenen „Umzugs“ hatten wir vier Stunden Zeit, um unsere Sachen zu packen. Jede Familie wurde mit ihrem Hab und Gut auf je einer Kutsche verladen und transportiert. Wir brauchten eine Nacht bis zu der Eisenbahnstation. Auf einem Zug ging es eineinhalb Monate weiter. Die Reise führte uns ins Ungewisse. Wir wussten nicht, wohin es gehen würde. Nur Frauen, Kinder und vereinzelt ältere Männer befanden sich im Zug, weil die übrigen Männer mobilisiert und in die Arbeitsarmee gezwungen wurden. Wir fuhren in einem Viehtransporter, welcher mehrfach bombardiert wurde. Die Not in den Waggons machte erfinderisch. Meine Mutter baute einen Ofen aus Ziegeln zum Heizen. Dieser Ofen brannte ein Loch in den Waggon, somit entstand eine Toilette. Unsere Zugfahrt führte uns letztendlich ins Altai-Gebiet in Sibirien.
Unter welchen Umständen lebten Sie nach der Zwangsumsiedlung?
Alle Menschen aus den Zügen wurden auf die Häuser der Einwohner verteilt. Mir kam das wie ein Sklavenmarkt vor, denn die ansässigen Familien suchten sich die Umsiedler aus wie Vieh. Die Bewohner waren auf der Suche nach Arbeitern. Da wir jedoch vier Kinder und eine ältere Frau waren, wollte uns niemand haben. Aus diesem Grund kamen wir weiter weg als die anderen, fast bis an die chinesische Grenze, 180 Meter von der Eisenbahnstation entfernt. Dort wurde uns zusammen mit einem älteren Ehepaar ein Zimmer in einem Haus zugeteilt. Der Mann starb jedoch nach wenigen Monaten an Hunger, unter dem wir alle litten. Wir lebten dort von 1941 bis 1947.
Wie machte sich das Leid bemerkbar?
Die Bewohner in dieser Region hatten nicht viel zu essen. Der Hunger begleitete uns durch diesen Abschnitt meines Lebens. Um an mehr Lebensmittel zu gelangen, versuchte meine Mutter Arbeit zu finden. Leider gab es nicht viele freie Stellen in dieser Region. Im Frühling arbeitete sie mit einem Spaten in dem Garten und meine älteste Schwester half ihr dabei. Als Lohn bekam sie ein paar Liter Milch am Tag. Als ich 16 wurde, fing ich ebenfalls an zu arbeiten, um meine Familie unterstützen zu können. Ich arbeitete als Dreher in einem großen Werk. Erst ab 1953 hörte das Hungerleiden auf. Bis dahin gab es sogenannte Essensmarken. Diese richteten sich nach der Schwere der Arbeit und dem Alter. Und man rationierte das Essen. Das Leid machte sich auch in unseren Besitztümern bemerkbar. Ich besaß kaum Kleidung und Schuhe und musste barfuß zur Schule gehen.
Wie sah Ihr Alltag bei dieser Familie aus?
Der Alltag in unserer zugeteilten Familie sah so aus, dass meine Mutter sich um das Essen kümmerte und Holz hackte zum Heizen. Wir erhielten zwei Säcke Weizen als Verpflegung, diesen kochten wir zu Brei. Der Weg, um an Fleisch zu kommen, war etwas ungewöhnlich. In unserem Bezirk war es so kalt, dass die Schafe erfroren. Um sie zu essen, taute meine Mutter sie wieder auf. Sie war eine Person, die nie aufgab, auch als Alleinerziehende ernährte sie uns und fand neue Wege zum Überleben. Sie hatte viel von meinem Vater gelernt, zum Beispiel einen Ofen zu bauen oder Körbe aus Ruten zu flechten. Diese Körbe haben wir gegen Kartoffeln getauscht. Wir erhielten so viele Kartoffeln, wie in einen Korb passten.
Welche Bildungsmöglichkeiten gab es?
Ich besuchte mit neun Jahren die erste Klasse einer Schule, auf die auch meine Schwestern gingen. Alle gingen unterschiedlich lang zur Schule. Meine älteste Schwester vier, die nächste sechs und die jüngste sieben Jahre lang. Ich besuchte zehn Klassen, arbeitete aber ab der 7. Klasse. Abends lernten wir alle in einer Abendschule weiter. Meiner Mutter war es sehr wichtig, dass wir ausreichend Bildung erhielten und die Möglichkeit zum Lernen hatten, obwohl die Regierung versuchte, uns in der Landwirtschaft zu halten und uns Aufstiegsmöglichkeiten zu verweigern. Aufgrund der Tatsache, dass wir Sowjetdeutsche waren, hatten wir nicht die Möglichkeit, Kultur und das Leben in anderen Städten mitzuerleben. Auch unser Recht auf Arbeit, Bildung, Freiheit und Urlaub wurden uns immer mehr aberkannt.
Inwieweit haben Sie den Krieg mitbekommen?
Viele verwundete Soldaten kamen aus dem Krieg zurück. Meine Schwester half ihnen beim Briefe schreiben und lesen. Sie hatte bereits Kinder und war verheiratet, somit hatte sie mehr Zeit. Wir wussten, was im Krieg vor sich ging, jedoch nicht durch die Medien, sondern durch Ankommende, die berichteten. Viele Männer waren gefallen, deren Briefe erreichten die jeweilige Familie verspätet. Viele Sowjetdeutsche wurden in die Arbeitsarmee gezwungen. Diese bestand aus Zwangsarbeit und dem Aufenthalt in einem Gefangenenlager, aus dem man nicht flüchten konnte. Die Männer wurden während des Krieges mobilisiert. Die Russen wurden als Soldaten an der Front eingesetzt. Da deutsche Männer nicht gegen die Deutschen kämpfen konnten, kamen sie in die Arbeitsarmee. Aus meiner Familie war dort jedoch keiner. Sie arbeiteten als Holzfäller oder in Gruben. Die Menschen bekamen dort sehr wenig zu essen, deshalb verhungerten viele. Ins Arbeitslager kamen alle im Alter von 17 bis 70. Ich war jedoch zu jung. Dort waren nur Männer und Frauen, deren Kinder über ein bis zwei Jahre alt waren. So lebten sie getrennt voneinander. Die Kinder kamen in eine Gemeinde. Einige fanden später wieder zusammen. Nur wenige kamen wieder nach Hause, und viele starben unter den beschwerlichen Umständen.
Wie verlief ihr Leben nach der Zwangsumsiedlung?
Im Jahr 1947 kamen wir aus Sibirien heraus, jedoch blieben wir immer noch im Altai-Gebiet, in Rubzowsk. Ich ging zur Schule und meine Schwestern arbeiteten. Mit 16 Jahren wollte ich ein College besuchen. Sie nahmen mich jedoch nicht an, da ich ein Deutscher war. Außerdem bildeten sie nur Kinder von gefallenen Vätern aus. Um Geld zu verdienen, arbeitete ich in einem Traktorenwerk als Dreherlehrling. Mit 19 hatte ich die zehnte Klasse beendet und ging zum Wehrdienst, das war Pflicht. Im Juli 1956 wurde ich eingezogen und arbeitete an einem Radargerät. Sie versprachen mir, dass ich nach dem Wehrdienst, der zwei Jahre dauerte, frei von der „Kommandantur“ sein werde. Das hieß, dass ich mir aussuchen konnte, wo ich leben wollte. Bis dahin durften wir unser Gebiet nicht verlassen. Im November 1956 wurde die „Kommandantur“ jedoch für alle abgeschafft. Somit erübrigte sich das Versprechen von allein. Beim Wehrdienst begann auch die Suche nach meinem Vater, die eher zufällig begann. Ich traf dort einen Mann vom Geheimdienst, der meinen seltenen Namen bemerkte. Ich erzählte ihm von dem Schicksal meines Vaters. Er riet mir, mich zur Aufklärung an das Gericht zu wenden. So schickte ich einen Brief dahin, und infolge dessen untersuchte das Gericht den Fall. Ich bekam jedoch keine Antwort. 1970 kam dann das Schreiben, dass er erschossen wurde, die Grabstelle jedoch nicht bekannt sei. Schriftlich haben wir es dann 1992 bei der Ausreise nach Deutschland bekommen. Die Begründung war, dass er rehabilitiert und unschuldig verurteilt worden sei.
Nach zwei Jahren Wehrdienst kam ich wieder ins Traktorenwerk und konnte mir in Rubzowsk ein eigenes Haus bauen. Dort heiratete ich auch, und wir bekamen zwei Kinder. 1964 zogen wir nach Kirgisistan, denn dort war das Klima besser. Da ich mein gebautes Haus verkauft habe, hatte ich Geld für den Umzug. Ich lebte in einer Wohnung und beendete mein College. Später arbeitete ich als Konstrukteur. Der Lohn war dort allerdings zu niedrig, so ging ich wieder zurück zur Drehbank. Von 1982 bis 1992 habe ich dann als Imker gearbeitet.
Weshalb haben Sie sich 1993 für den Umzug nach Deutschland entschieden?
Seit 1993 lebe ich in Deutschland. Die Bearbeitung des Antrags dauerte zwei Jahre. 1992 erhielten wir den Aufnahmebescheid. Der Grund, weswegen wir nach Deutschland wollten, war endlich als Deutsche anerkannt zu werden und zurück in unsere Heimat zu kommen. In den anderen Ländern, in denen wir gelebt hatten, waren wir manchmal als Sowjetdeutsche willkommen, manchmal verhasst, dies kam ganz auf die Regierung an. Hier werden wir auch nicht als „richtige“ Deutsche angesehen, aber meine Enkelkinder können teilweise nicht mal mehr Russisch. Ich habe vier Enkelkinder und zwei Urenkel, die alle hier leben. Wir wohnen verteilt in Harburg und Allermöhe.
Wie gehen sie mit der deutschen Vergangenheit um?
Ich hatte nie einen Hass auf die Deutschen wegen der Nationalsozialisten. Der Befehl kam von der Regierung und die einfachen Menschen konnten ja nichts ändern. Wir werden zwar nicht immer als Deutsche anerkannt, jedoch finde ich das verständlich. Man muss auch andere verstehen können. Wir wurden damals zwar öfter als Faschisten beschimpft, aber eher von der Regierung unter Stalin tief beleidigt und unterdrückt.
Wir trauern um die Redaktionsmitglieder, die uns für immer verlassen haben.





Unsere Ziele sind relativ schnell formuliert. Wir wollen einen Beitrag zu lebendiger Erinnerungskultur leisten, indem wir individuelle Geschichten und Erfahrungen einer breiten Masse zugänglich machen. Ebenso fördern wir mit unserem Projekt auf unterschiedlichen Ebenen den Austausch zwischen verschiedenen Generationen, die viel voneinander lernen können

Freitag, 28. November 2025 – 15 bis 18 Uhr