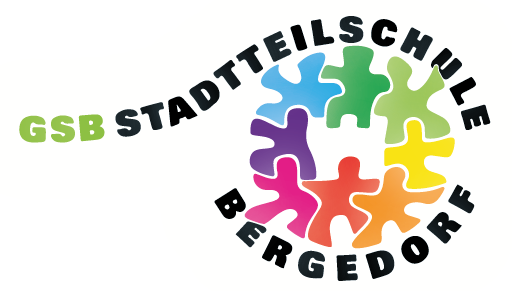Leyla ist die Tochter zweier Gastarbeiter, die in den 1950er Jahren nach Deutschland geholt wurden, um das Arbeiterdefizit der späten Nachkriegszeit auszugleichen.
Ergebnisse eines Interviews mit Leyla G. (*1962)
Wann genau kam deine Familie nach Deutschland?
Meine Mutter ging 1964 nach Deutschland, um dort zu arbeiten. Ich war zu dieser Zeit gerade mal drei Jahre alt, also noch sehr klein. Mein Vater ging 1965, mein älterer Bruder und ich blieben zurück, da es nicht gedacht war, dass Kinder mitreisten. Wir lebten fortan bei meiner Oma und meinem Opa. Sie besaßen ein einfaches Mietshaus in der Stadt. Es war nicht viel Platz, aber es ging. Wir lebten dort mit einem großen Teil der Familie. Mit Onkeln und Tanten und auch meinen Cousinen und Cousins. Neun Kinder von meinem Onkel, ich und mein Bruder. Solch große Familien waren damals völlig normal. Es war niemals langweilig und für uns wurde gut gesorgt.
Wie war es für dich ohne deine Mutter und deinen Vater?
Es war anders, ich habe sie natürlich sehr vermisst. Manchmal wachte ich mitten in der Nacht auf, weil ich von ihnen geträumt habe. Mein Opa und meine Oma haben sich gut um uns gekümmert. Das ist in türkischen Familien nun mal so. Trotzdem habe ich mich immer etwas einsam gefühlt. Das Leben, ohne meine Eltern, machte mich schon früh selbständig denke ich, weil meine Großeltern ja eine Menge zu tun hatten. Somit war nicht immer jemand da, der einem helfen konnte. Man musste also vieles selber machen. Ich war viel draußen, habe gespielt und bin zum Schwimmen gegangen. Wir wohnten ja in der Nähe des Meers, so wie früher auch. Es war halt nur nicht immer jemand da, der auf einen aufgepasst hat.
Gab es irgendeine Kommunikation zwischen dir und deinen Eltern als sie in Deutschland waren?
Ja, die gab es. Aber es war damals natürlich etwas schwieriger als heute. Ohne Internet gab es nur das Telefon oder Briefe. Da wir kein Haustelefon besaßen, schrieb mein Onkel Briefe. So erfuhren wir, wie es unseren Eltern ging. Es gab nicht viele Informationen, aber wenigstens etwas. Besser als nichts über ihr Leben zu wissen. Oder ob es ihnen gut ging und wie es so in Deutschland war.
Hattest du den Gedanken, dass dich deine Eltern nachholen würden?
Ich glaube nicht, nein. Sie waren da, um zu arbeiten, und ich war bei meinen Großeltern gut untergebracht. Ich glaube, dass das zuerst auch gar nicht vorgesehen war und erst viel später entschieden wurde.
Wann und wie kamen dein Bruder und du letztendlich nach Deutschland?
Das war 1968, also drei Jahre nachdem mein Vater nach Deutschland ging. Wie schon gesagt, war es ja zuerst nicht vorgesehen, dass die Familien, also meist die Kinder, nachkamen. Aber dann gab es doch die Familienzusammenführung. Mein Bruder war zu diesem Zeitpunkt neun und ich war sechs Jahre alt. Mein Vater und meine Mutter holten uns mit dem Auto ab. Wir fuhren also nach Deutschland. Es war sehr aufregend, aber auch anstrengend. Ich war ja noch ein kleines Mädchen und dann ist eine so lange Fahrt nicht einfach. Ich war natürlich sehr gespannt auf Deutschland. Ich erinnre mich, dass wir sogar noch einen Anhalter mitgenommen haben.
Wie waren deine ersten Erfahrungen?
Meine Ankunft war für mich, als wir in Wentorf ankamen. Da hatten meine Eltern eine Wohnung bekommen. Nicht sehr groß, eher einfach gehalten. Eine Ein-Zimmer- Wohnung. Es war weniger Platz als bei meiner Oma und meinem Opa, obwohl wir natürlich deutlich weniger Leute waren. Es war aber gut auszuhalten. Wir blieben allerdings nicht lange in Wentorf. Wir zogen in eine Wohnung in Neu-Schönningstedt. Dort habe ich dann, bis zu meinem Auszug, mit meinen Eltern gelebt. Die Umstellung war zu Anfang sehr schwierig, da das Leben doch stark anders war, als wie ich es gewohnt war. In der Türkei habe ich immer draußen gespielt, den ganzen Tag. Hier war das schwieriger. Es gab nicht wirklich große Spielplätze und da wir nun eher in der Stadt lebten, auch weniger Natur. Dazu konnte ich ja kein Wort Deutsch und kannte auch niemanden. Das Wetter war ebenfalls eine große Umstellung. Ich war ein deutlich wärmeres Klima gewöhnt. Dann wurde ich auch schon bald eingeschult.
Wie war die Schulzeit für dich?
Zu Beginn natürlich sehr schwierig. Ich bin nie in einem Kindergarten gewesen. In der Türkei war ich auch noch nicht in der Schule, weil ich ja noch zu jung war. Ich hatte bis dahin noch nie einen Stift in der Hand gehabt, geschweige denn, damit geschrieben. Ein Buch besaß ich auch noch nicht. Das alles war vollkommen neu für mich und überwältigte mich etwas. Dazu kam das große Problem, dass ich ja kein Wort Deutsch sprach. Die Lehrer konnten zu dieser Zeit nicht recht etwas mit uns anfangen. Wir waren die ersten türkischen Kinder und die Lehrer waren noch nicht darauf eingestellt. Ich sage wir, weil ich und mein Bruder zusammen eingeschult wurden. Er war zwar in der Türkei schon zur Schule gegangen, aber hier wurden wir zusammen in eine Klasse gesteckt. Das war allerdings nicht lange so, da mein Bruder einige Klassen übersprang, um mit Kindern in seinem Alter zur Schule zu gehen. Somit blieb ich alleine zurück. Es fiel mir schwer, die deutsche Sprache zu lernen. Deshalb musste ich die erste Klasse auch wiederholen. Mir konnte so niemand wirklich helfen. Mein Bruder war nun in einer anderen Klasse und meine Eltern waren ja den ganzen Tag lang arbeiten. Sie gingen morgens aus dem Haus und kamen abends erschöpft wieder. Außerdem sprachen sie auch nicht so gutes Deutsch, dass sie mir bei meinen Schulaufgaben wirklich hätten helfen konnten. Sie konnten das, was man zum täglichen Leben brauchte. Ich versuchte immer fleißig und aufmerksam zu sein, auch ohne, dass ich die Sprache wirklich beherrschte. Solche Disziplin war sehr neu für mich, da ich ja bisher immer nur draußen gespielt hatte und dort natürlich machen konnte, was ich wollte. Dieser Gedanke des Einfügens, wenn man es so nennen darf, war sehr neu für mich. Es gab nur einmal einen Vorfall mit anderen Schülern. Ein paar deutsche Jungs haben mir und meinem Bruder nach der Schule immer aufgelauert und uns abgefangen. Sie haben uns dann rumgeschubst und gehänselt. Als meine Mutter das hörte, hat sie sich sofort in der Schule beschwert und dann hat das auch sofort aufgehört. Sonst war meine Grundschulzeit sehr schön. Ich kam mit den anderen Kindern sehr gut zurecht. Wir haben viel gespielt und ich hab auch neue Freunde gefunden.
Wie war deine restliche Schulzeit und was hast du dann nach der Schule gemacht?
Die restliche Schulzeit war ganz normal, würde ich sagen. Die Sprache war natürlich weiterhin nicht so einfach, aber ich lernte sehr schnell. Dazu gab es eine Lehrerin, die sich unser angenommen hat. Die meisten Lehrer ließen uns links liegen, doch diese Lehrerin, Frau Kuhlke, setzte sich sehr für uns ein. Sie hatte selber Kinder und sorgte dafür, dass es eine Sprachförderung für uns gab. Was heute an den meisten Schulen fast selbstverständlich ist, war damals etwas sehr Besonderes. Mein Deutsch wurde immer besser, so konnte ich auch meinen Eltern helfen. Für sie gab es keine Sprachkurse und so begleitete ich sie bei vielen Behördengängen, um zu übersetzen. Ich machte dann meinen Hauptschulabschluss. Da mir das aber nicht genug war, ging ich danach noch zwei Jahre auf eine so genannte „Hauswirtschaftsschule“ und machte meinen Realschulabschluss nach. Ich wollte eigentlich immer Friseurin werden, doch ich fing dann nach der Schule eine Ausbildung zur Krankenschwester an.
Wie war die Zeit in der Ausbildung?
Es hat mir von vorn herein sehr gefallen. Ich mochte dieses Gefühl, mich um Menschen zu kümmern und für sie zu sorgen. Die Ausbildung dauerte drei Jahre. Ich war damals im Krankenhaus Wandsbek. Es war immer viel zu tun, aber ich hab es gern gemacht und mich wohl gefühlt. Meine Kollegen haben mich gut angenommen. Das Gefühl von Ablehnung hatte ich jedenfalls nicht. Es wurde normal mit mir umgegangen. Ich meine, es gab nicht wirklich eine Art Abneigung, weil ich Ausländerin bin. So etwas hatte ich in der ganzen Ausbildung nur einmal bei einer Kollegin erlebt. Nach der Ausbildung bin ich dann nach Eilbek versetzt worden, in eine Blutspende Praxis. Diese Arbeit hat mir allerdings nicht so gut gefallen. Es war immer sehr viel zu tun, immer sehr stressig. Mir fehlten doch etwas die kranken Menschen. Dieser helfende Gedanke war nicht mehr da. Dort arbeitete ich nun bis 2008. Dann kam ich zum Bergedorfer Gesundheitsamt. Nebenbei hatte ich bereits geheiratet und eine Tochter geboren. Das Gesundheitsamt war eine Umstellung für mich. Vom doch eher lebhaften Arbeiten in der Blutspende Praxis in das Verwaltungsleben einzusteigen. Es war entspannteres Arbeiten, so kam es mir vor. Ich war dort eher ein Exot, kann man sagen. Ausländische Mitarbeiter gab es bis dato nicht und ich wurde klar in Klischees gezwängt. Alle hatten eine Vorstellung wie ein „Ausländer“ war. Dabei ist zu bedenken, dass ich nun schon 40 Jahre in Deutschland lebte. Ich habe eine Menge verändert und aufgerüttelt und heute fühle ich mich sehr wohl. Trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass ich immer noch etwas anders bin, oder so angesehen werde.
Ich fühle mich hier in Deutschland sehr wohl und habe auch meine Familie hier. Wenn ich irgendwann alt bin und in Rente gehe, würde ich gerne zurück in die Türkei. Ich würde gerne an einem wärmeren Ort sein und da ich die Sprache natürlich noch spreche, wäre das ein sehr guter Ort für mich.
Wir trauern um die Redaktionsmitglieder, die uns für immer verlassen haben.





Unsere Ziele sind relativ schnell formuliert. Wir wollen einen Beitrag zu lebendiger Erinnerungskultur leisten, indem wir individuelle Geschichten und Erfahrungen einer breiten Masse zugänglich machen. Ebenso fördern wir mit unserem Projekt auf unterschiedlichen Ebenen den Austausch zwischen verschiedenen Generationen, die viel voneinander lernen können

Freitag, 28. November 2025 – 15 bis 18 Uhr