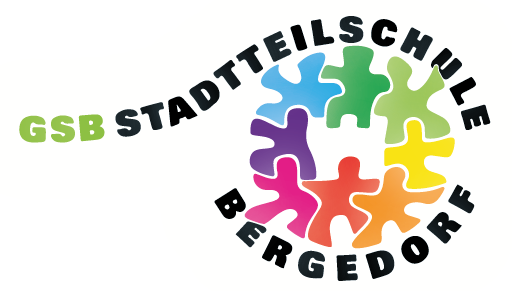Ergebnisse eines Interviews mit Jochen Stern (*1928)
Herr Stern, Sie wurden 1928 in Frankfurt an der Oder geboren. Hier besuchten Sie zunächst die Volkshochschule und dann gingen Sie auf das Gymnasium. 1943 wurden Sie in die Wehrmacht eingezogen. Sie dienten dann bis 1945 als Luftwaffenhelfer.
Wie erlebten Sie ihre Heimatstadt, als Sie im Juli 1945 in diese zurückkehrten?
Man musste sich ganz klar erst einmal wieder einfinden. Frankfurt war in der Innenstadt eine vollkommene Trümmerstadt. Alles war natürlich zerbombt worden. Alle, die evakuiert waren, kamen nach und nach zurück und fanden nichts als Schutt und Asche. Zum Glück wohnte ich und meine Eltern noch etwas außerhalb der Stadtmitte. Unser Haus war natürlich ausgeräumt, da hatten sich Russen, Polen und Deutsche bedient. Nachdem ich dann also gecheckt war, also auf Belastung im Nationalsozialismus, und ich für „nicht belastet“ befunden wurde, hieß es sehen, wie es weiter gehen soll. Da gab es einige Möglichkeiten.
Welche Möglichkeiten gab es für Sie nach dem Krieg und welche ergriffen Sie dann?
Man gab mir zwei Möglichkeiten: Entweder Senftenberg, das war eine Kohlengrube, oder Schulamtsbewerber, so nannte man das damals. Ich habe mich natürlich für Letzteres entschieden und wurde dann sogenannter Junglehrer. In einer achtmonatigen Ausbildung wurde mir alles beigebracht, was ich zu wissen brauchte. Methodik, Philosophie, Psychologie und Soziologie. Das machten wir alles im Schnellverfahren. Wir hatten extra spezielle Dozenten, die nur uns unterrichteten. Man hatte ja sowieso alle Lehrer der NS-Zeit entlassen, ob sie nun Parteimitglied waren oder nicht. Diese Ausbildung begann ich mit siebzehn. Zehn Tage vor meinem achtzehnten Geburtstag.
Wie ging es für Sie nach den acht Monaten Ausbildung weiter?
Also nach den acht Monaten Ausbildung kam ich zur „Pestalozzi“ Schule, Frankfurt- Oder. Das war zu Beginn eine reine Grundschule, doch später wurde sie ausgebaut. Heute würde man Gesamtschule dazu sagen. Wir hatten dann Grundschule, Mittelstufe und Oberstufe. So ist es ja heute immer noch eingeteilt. Der Unterricht selbst hat mir überraschend viel Spaß gemacht. Obwohl es manchmal schwierig war mit den überalterten Schülern. Durch den Krieg und die Flucht vor eben dem waren sie ja nicht in der Schule gewesen und nun viel älter, als die Klassenstufe, in der sie sich befanden.
Hatten Sie politische Berührungspunkte?
Ja, die gab es in der Tat. Schon in der Ausbildung versuchte man, uns Lehrer politisch einzufangen. Sie sagten, wir seien Vorbilder und müssten uns deshalb entscheiden. Es gab ja nur noch vier Parteien. Die SPD und die KPD, die sich später zur SED (Sozialistischen Einheitspartei Deutschland) zusammenschlossen. Die CDU Ost und die LDP. SPD und KPD schlossen sich zusammen, da man sich schon denken konnte, dass bei den möglichen Wahlen, die vielleicht schon 1946 anstehen könnten, die KPD nicht alleine durchkommen würde. Viele von uns wollten nicht ganz verstehen, warum in der SED die Männer der KPD immer die stärkeren Positionen besetzten. Ich entschied mich, nach intensiver Recherche, dann für die LDP. Diese Entscheidung war sofort zu spüren. Ich durfte in der Schule, das Fach Geschichte, nicht mehr unterrichten, ausgerechnet mein Lieblingsfach.
Hatte diese Entscheidung noch weitere Folgen für Sie?
Ja natürlich. Ich wurde sofort bespitzelt und überwacht. Das fand ich allerdings erst später heraus. Um es kurz zu machen, am 14. Oktober 1947 standen dann Rotarmisten vor meiner Haustür. Klingelten, stürmten herein und nahmen mich kurzerhand fest. Sie kamen sehr früh, gegen halb fünf Uhr Morgens, und ehe ich so wirklich wach wurde, hatte ich schon eine Waffe vor der Nase und wurde gefragt, wo ich meine Pistole hätte, auf Russisch natürlich. Dann die Treppe runter, in einen Jeep rein, in die Dependenz der NKWD (sowjetisches Volkskommissariat für innere Angelegenheiten) in Frankfurt/Oder. Dort wurde ich erst in einen Keller gesperrt und von dort aus weiter transportiert. An dem Tag wurden 14 Personen verhaftet. Beim Weitertransport durfte ich dann im BMW sitzen, während der Rest auf einem LKW hinter uns fahren musste. Das bemerkte ich erst mit der Zeit und wunderte mich natürlich. Wie ich dann später erfuhr, hielten sie mich für einen ganz großen Fisch. Sie dachten, ich sei ein Spion, der ein Spionagenetz von Stettin bis Görlitz aufgebaut hatte. Deshalb durfte ich dann auch im BMW fahren. Das muss man sich mal vorstellen. Ich war gerade 18. Nun fuhren wir nach Potsdam, dort befand sich die Hauptuntersuchungsbehörde des NKWD für Brandenburg. Dort wurden wir dann durchsucht und in die Zelle gesperrt. Keiner beschäftigte sich mit uns, wir waren einfach erst einmal weggesperrt. Ich klopfte und sagte dem Schließer, der kam, dass ich einen Offizier sprechen wolle. Beim zweiten Mal kam dann ein Offizier, mit dem ich sprechen konnte. Dem sagte ich, dass das ein Versehen sei, dass ich nichts getan hätte und dass es eine Verwechslung sein müsse. Darauf antwortete er nur: „Wer hier sitzt, ist schuldig“. Tür zu und da saß ich dann. Nach drei, vier Tagen kam dann das Übliche. Mir wurden die Haare abrasiert, die Fingerabdrücke genommen, Frontal- und Seitenbild wurden aufgenommen. Alles ohne ein einziges Verhör. „Wer hier sitzt, ist schuldig“, also wozu die Eile. Ich war ja schon schuldig. Es dauerte acht Tage. Dann kam das erste Verhör. Das war grausam, weil ich die ganze Zeit stehen musste. Der Verhöroffizier saß mir gegenüber auf seinem Stuhl hinter seinem Schreibtisch, las seine Zeitschriften und rauchte seine Zigaretten. Links von mir saß die Dolmetscherin. Die beiden unterhielten sich ab und an und so verstrich dann die Zeit. Ich kann nicht genau sagen, wie lange, aber nach so ein, zwei Stunden fragte er dann: „Kennst du den und den?“. Es wurde nicht gefragt, wer ich sei, oder so etwas, das kam nicht beim ersten Verhör. Ich sagte dann, dass ich die Personen nicht kannte und er sagte dann immer „Du lugen“, also er sprach nicht wirklich Deutsch. Nach einer weiteren Stunde stand er dann plötzlich auf, ging zum Kachelofen und spuckte drauf. Der Speichel floss an den Kacheln herunter und zischte nur leise. Dann nahm er sich einen der Holzscheite aus dem Feuer und kam zu mir, stellte sich ganz dicht vor mich und sagte: „Du Spion, du hast furchtbar gegen uns gearbeitet, gegen Sowjetunion.“ und dann nahm er den Holzscheit hoch und benutzte ihn wie ein Fallbeil und ließ mir das glühende Ende auf den Kopf fallen. Die Schmerzen waren unerträglich. Ich hatte ja eine Glatze. Dann hat er sich noch kurz etwas notiert, und ich kam wieder in meine Zelle. Am nächsten Tag kam ich dann wieder in den Raum und da wurde mir dann gesagt, wie ich bereits erwähnte, dass ich ein Spionagenetz zwischen Görlitz und Stettin aufgebaut hätte. Ich wusste wirklich nicht, was ich dazu sagen sollte, ich war geplättet. Dann kamen noch ein paar Verhöre, aber nicht all zu viele, und dann stellten sie fest, dass ich wohl doch nicht so der große Spion war. Sie änderten die Anschuldigung auf „Antisowjetische Propaganda“. In dem Tagebuch, dass sie bei mir fanden, hatte ich geschildert, wie ich einmal gesehen hab, dass ein russischer Offizier eine Frau vor dem späteren Kleist-Theater belästigte. Jetzt hatten sie mich aber. Ich bekam Prügel, wie noch nie zuvor in meinem Leben. Dann, nach der Verurteilung, kam ich nach Bautzen. Hier musste ich 25 Jahre meines Lebens vergeuden.
Wir trauern um die Redaktionsmitglieder, die uns für immer verlassen haben.





Unsere Ziele sind relativ schnell formuliert. Wir wollen einen Beitrag zu lebendiger Erinnerungskultur leisten, indem wir individuelle Geschichten und Erfahrungen einer breiten Masse zugänglich machen. Ebenso fördern wir mit unserem Projekt auf unterschiedlichen Ebenen den Austausch zwischen verschiedenen Generationen, die viel voneinander lernen können

Freitag, 28. November 2025 – 15 bis 18 Uhr